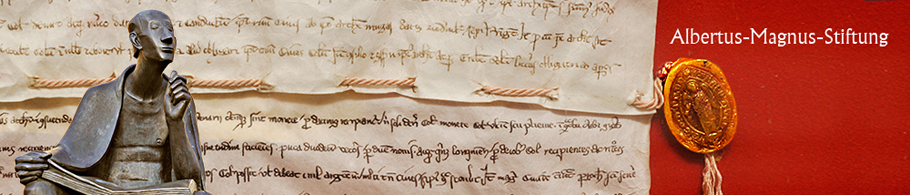Stiftungsurkunde
Präambel:
In der europäischen Geistesgeschichte besitzt Albert der Große einen einzigartigen Rang. Sein immenses Werk hat nicht nur den Gang des theologischen und philosophischen Denkens tief beeinflusst; durch seine gezielte Erschließung der umfangreichen Quellen antiker, jüdischer und islamischer Wissenschaft hat er dem lateinischen Westen den Weg in die neuzeitlich-moderne Wissenschaftsgesellschaft geöffnet. Sein Konzept des kritischen Zusammenwirkens der verschiedenen Wissenschaften auf gemeinsamem Boden wurde für die neu entstehende Institution der Universität die Formel, die sie zu dem weltweit erfolgreichen Ort von Forschung und Lehre werden ließ.
Durch sein Leben und Wirken ist Albert der Große untrennbar mit der Stadt Köln verbunden. Sein Grab befindet sich seit 1803 unweit des Domes in der Kirche St. Andreas. Mit der Errichtung des Kölner Generalstudiums der Dominikaner im Jahr 1248 legte er den Grundstein für die Entwicklung Kölns zu einem weltweit ausstrahlenden Zentrum universitärer Bildung, wissenschaftlicher Forschung und kulturellen Lebens. Durch sein erfolgreiches Wirken als Ratgeber und Friedensvermittler ("Großer Schied") prägte er die politische Entwicklung der Stadt und begründete das bis heute fruchtbare und die Stadt prägende Zusammenwirken von Kirche und Bürgerschaft. Aufgrund der weltweiten und bis heute andauernden Wirkung seines universalen wissenschaftlichen Werks, seiner Schlüsselstellung in der europäischen Geistesgeschichte und seiner historischen Bedeutung für die Entwicklung der Stadt Köln muss er unter den Beiträgen Kölns zum Weltkulturerbe an erster Stelle genannt werden. Das bedeutende Œuvre Alberts des Großen, das theologische, philosophische und naturwissenschaftliche Werke umfasst, ist bis heute nicht in einer vollständigen wissenschaftlich zuverlässigen Ausgabe verfügbar. In einer Zeit, die der Vergewisserung der geistesgeschichtlichen Wurzeln der Moderne und angesichts der rapiden Entwicklung der modernen Naturwissenschaften des Brückenschlags zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften besonders bedarf, ist es deshalb das gemeinsame Anliegen des Erzbistums Köln sowie aller, die sich der durch Albert den Großen begründeten Tradition verpflichtet wissen, dieses bedeutende kulturelle Erbe langfristig zu sichern. Die Albertus-Magnus-Stiftung will das Albertus-Magnus-Institut bei der Erfüllung dieser Aufgabe unterstützen.
§1 Name, Rechtsform, Sitz
1) Die Stiftung führt den Namen „Albertus-Magnus-Stiftung“.
2) Sie ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung im Sinne des § 13 StiftG NRW und § 1 der
Stiftungsordnung für das Erzbistum Köln.
3) Kirchenrechtlich hat sie die Stellung einer selbstständigen frommen Stiftung im Sinne von can.
1303 § 1 CIC. Ihr wurde vom Erzbischof von Köln gemäß can. 114 § 1 CIC durch
bischöfliches Dekret vom 04.05.2006 die Rechtsstellung einer privaten juristischen Person im
Sinne des Kirchenrechtes verliehen.
4) Sitz der Stiftung ist Köln.
§2 Stiftungszweck
1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
2) Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung im Bereich des
Erzbistums Köln.
Dieser Zweck wird insbesondere durch die Herausgabe der „kritischen Edition" der Werke von
Albertus Magnus verfolgt. Außerdem unterstützt die Stiftung die wissenschaftliche Arbeit des
Albertus-Magnus-Institutes; diese Unterstützung kann sowohl durch finanzielle Zuwendungen
als auch durch sonstige Maßnahmen erfolgen, durch welche die Arbeit des Institutes gefördert
wird.
Zur Verwirklichung dieses Zweckes arbeitet die Stiftung eng mit dem Albertus-Magnus-Institut
zusammen; bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bedient sie sich der Mitarbeiter des Albertus-
Magnus-Institutes.
3) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
4) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Stifter, die Zustifter und deren Erben erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung.
5) Soweit die Stiftung ihre Zwecke nicht selbst verwirklicht, kann sie ihre Mittel ganz oder
teilweise anderen steuerbegünstigten Körperschaften oder kirchlichen Körperschaften des
öffentlichen Rechts zur Verfügung stellen, die damit Zwecke im Sinne des Absatzes 2
verfolgen.
§3 Erhaltung des Stiftungsvermögens
1) Das Stiftungsvermögen ergibt sich aus dem Stiftungsgeschäft.
2) Es ist in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten.
In begründeten Ausnahmefällen ist es jedoch - mit Zustimmung der kirchlichen
Stiftungsaufsichtsbehörde - gestattet, während eines Geschäftsjahres Mittel aus dem
Stiftungskapital zu entnehmen, sofern sichergestellt ist, dass diese Mittel dem Stiftungskapital
innerhalb der ersten sechs Monate des folgenden Geschäftsjahres wieder zugeführt werden.
3) Dem Stiftungsvermögen wachsen die Zuwendungen Dritter zu, die dazu bestimmt sind.
§4 Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen
1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur
Erfüllung des Stiftungszwecks zeitnah zu verwenden.
2) Rücklagen dürfen gebildet werden, soweit dies die Vorschriften der Abgabenordnung über die
Gemeinnützigkeit nach Art und Umfang zulassen.
3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§5 Rechtsstellung der Begünstigten
Den durch die Stiftung Begünstigten steht auf Grund dieser Satzung ein Rechtsanspruch auf
Leistungen der Stiftung nicht zu.
§6 Organe und Gremien der Stiftung
1) Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand.
2) Als weiteres Gremium kann die Stiftung ein Kuratorium bilden. Das Kuratorium ist nicht Organ
der Stiftung.
3) Die Mitglieder des Stiftungsrats, des Kuratoriums und des Vorstandes werden ehrenamtlich
tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz der ihnen entstandenen Auslagen und Aufwendungen.
§7 Zusammensetzung des Stiftungsrats
1) Der Stiftungsrat besteht aus 5 Personen.
2) Jeweils ein Mitglied wird vom "Wissenschaftlicher Beirat der Edition" des Albertus-Magnus-Institutes,
vom "Wissenschaftlicher Beirat für Forschung und Lehre" (vgl. Amtsblatt des Erzbistums Köln vom 01.01.2012,
Nr. 2) und vom Erzbischof von Köln berufen. Die Berufung dieser Personen erfolgt jeweils auf vier Jahre.
3) Zwei weitere Mitglieder werden durch die Mitglieder des Stiftungsrates nach Ziffer 2
hinzugewählt. Sofern ein Kuratorium bestellt ist, sind nur Mitglieder des Kuratoriums
zuwählbar. Das Kuratorium besitzt in diesem Fall für die Zuwahl ein Vorschlagsrecht. Die
Zuwahl erfolgt für die Amtsdauer der Mitglieder des Stiftungsrates nach Ziffer 2.
4) Beim vorzeitigen Ausscheiden eines Mitgliedes bestimmt die entsendende Stelle für die
restliche Dauer der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes ein Ersatzmitglied. Die von den
Beiräten benannten Mitglieder müssen diesen Beiräten angehören. Mit ihrem Ausscheiden
aus dem jeweiligen Beirat endet auch ihre Mitgliedschaft im Stiftungsrat.
5) Der Stiftungsrat wählt aus seinen Reihen den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
§8 Beschlussfassung des Stiftungsrats
1) Die Sitzungen des Stiftungsrates können sowohl in Präsenz, virtuell oder in hybrider Form
(eine Kombination der vorgenannten Sitzungsformen) durchgeführt werden. Weiterhin sind Beschlüsse
in schriftlichem oder elektronischem Umlaufverfahren zulässig.
2) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Stiftungsratsmitglieder teilnehmen,
von denen eines der Vorsitzende oder sein Stellvertreter sein muss.
3) Er wird vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter bei Bedarf - jedoch mindestens einmal
jährlich - schriftlich unter Angabe des Beratungsgegenstandes einberufen. Eine Einberufung
hat ferner zu erfolgen, wenn ein Stiftungsratsmitglied dies verlangt.
4) Der Stiftungsrat entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit die
Satzung nichts Anderweitiges vorschreibt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Vorsitzenden den Ausschlag.
5) Über die Beschlüsse des Stiftungsrats ist ein Protokoll zu führen, welches vom Protokollführer
und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.
§9 Aufgaben des Stiftungsrats
1) Der Stiftungsrat hat im Rahmen des Stiftungsgeschäftes und der Stiftungssatzung darauf zu
achten, dass der Wille des Stifters so wirksam wie möglich erfüllt wird.
2) Er kann dem Vorstand Weisungen erteilen. Ihm obliegen insbesondere Entscheidungen über:
a) Grundsatzfragen,
b) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers,
c) Feststellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses,
d) Wahl eines Vorstandsmitgliedes gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung,
e) Entlastung des Vorstandes,
f) Änderungen der Satzung und die Auflösung der Stiftung.
3) Der Stiftungsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.
§10 Zusammensetzung und Beschlussfassung des Vorstandes
1) Der Vorstand besteht aus dem Direktor des Albertus-Magnus-Institutes als Vorsitzendem,
dem Institutsleiter als stellvertretendem Vorsitzendem und einem weiteren vom Stiftungsrat auf die
Dauer von vier Jahren gewählten Mitglied. Das gewählte Mitglied soll nach Möglichkeit
dem Kreis der Zustifter angehören.
2) Bei einem Ausscheiden des gewählten Mitgliedes wird dessen Nachfolger vom Stiftungsrat
gewählt.
3) Der Vorsitzende oder bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter hat den Vorstand
fernmündlich oder schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 1 Woche einzuberufen. Auf die
Einhaltung dieser Frist und der Schriftform kann mit Zustimmung aller Vorstandsmitglieder
verzichtet werden.
4) Die Sitzungen des Vorstandes können sowohl in Präsenz, virtuell oder hybrider Form
(eine Kombination der vorgenannten Sitzungsformen) durchgeführt werden. Weiterhin sind Beschlüsse
in schriftlichem oder elektronischem Umlaufverfahren zulässig.
5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 seiner Mitglieder teilnehmen.
Beschlüsse des Vorstandes werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
6) Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren und vom Vorsitzenden oder seinem
Stellvertreter zu unterzeichnen.
§11 Rechte und Pflichten des Vorstandes
1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Stiftung und vertritt diese gerichtlich und
außergerichtlich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Zur Abgabe
rechtsgeschäftlicher Erklärungen bedarf es jeweils der Unterschrift von zwei Mitgliedern des
Vorstandes.
2) Der Vorstand hat im Rahmen des Stiftungsgesetzes und dieser Satzung den Willen der Stifter
so wirksam wie möglich zu erfüllen. Seine Aufgabe ist insbesondere:
a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der Führung von Büchern und die
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Wirtschaftsplanes,
b) die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträgnisse des Stiftungsvermögens sowie
über andere der Stiftung gemachten Zuwendungen.
§12 Kuratorium
1) Sofern der Stiftungsrat ein Kuratorium bestellt, hat dieses mindestens fünf Mitglieder.
2) Mitglieder des Kuratoriums können werden:
a) Frauen und Männer des öffentlichen Lebens, die die Stiftung in besonderer Weise
unterstützen,
b) juristische Personen und Vertreter von Institutionen, die den Stiftungszweck nachhaltig
fördern.
3) Die Mitglieder des Kuratoriums werden vom Stiftungsrat bestellt.
4) Die Mitglieder des Kuratoriums werden auf die Dauer von fünf Jahren bestellt.
Wiederbestellung ist zulässig.
§13 Aufgaben des Kuratoriums
1) Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und seinen Stellvertreter.
2) Das Kuratorium berät den Vorstand bei seiner Stiftungsarbeit.
3) Die Mitglieder des Kuratoriums werben für die Arbeit und für die Verwirklichung der Ziele der
Albertus-Magnus-Stiftung. Sie bemühen sich um Zuwendungen (Zustiftungen und Spenden)
an die Stiftung.
§14 Einberufung und Beschlussfassung des Kuratoriums
1) Das Kuratorium tagt mindestens einmal im Jahr.
2) Das Kuratorium wird vom Vorsitzenden des Kuratoriums oder im Verhinderungsfall von
seinem Stellvertreter einberufen. Es ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder
ordnungsgemäß geladen und mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen Mitglieder, darunter
der Vorsitzende des Kuratoriums oder sein Stellvertreter, anwesend sind.
3) Das Kuratorium fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss als nicht zustande gekommen.
4) Über die Sitzungen sind Ergebnisniederschriften zu fertigen, die vom Vorsitzenden und von
einem weiteren Mitglied des Kuratoriums zu unterzeichnen sind.
5) Die Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an den Sitzungen des Kuratoriums beratend
teilzunehmen.
6) Die Sitzungen des Kuratoriums sind nicht öffentlich.
§15 Kirchliche Bindung
1) Unbeschadet stiftungsrechtlicher Normen unterliegt die Stiftung nach Maßgabe des
Kirchenrechtes der Aufsicht des Erzbischofs von Köln. Die vom Erzbischof von Köln erlassene
Stiftungsordnung ist in ihrer jeweiligen Fassung für die Stiftung verbindlich.
2) Die Stiftung erkennt die vom Erzbischof von Köln erlassene "Grundordnung des kirchlichen
Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse" (Amtsblatt des Erzbistums Köln vom
15.10.1993, Seite 222 ff., in der Fassung vom 02.08.2011, Amtsblatt vom 01.09.2011, Seite 226 f.)
sowie das Mitarbeitervertretungsrecht für die Erzdiözese Köln (Amtsblatt des Erzbistums
Köln vom 30.09.2011, Seite 241 ff.) und die dazu ergangenen Regelungen und Ausführungsbestimmungen
in der jeweils geltenden Fassung als verbindlich an und wird diese anwenden. Das Gleiche gilt,
wenn die vorgenannten Bestimmungen durch andere Regelungen ersetzt werden.
3) Die Stiftungsaufsichtsbehörde ist auf Wunsch jederzeit über alle Angelegenheiten der Stiftung
zu unterrichten. Ihr ist unaufgefordert der Jahresabschluss einzureichen.
4) Die "Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder
hilfsbedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst" findet in
ihrer jeweils geltenden, im Amtsblatt der Erzdiözese Köln veröffentlichen Fassung Anwendung.
§16 Anpassung der Stiftung an veränderte Verhältnisse
1) Ändern sich die Verhältnisse derart, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks vom Stiftungsrat
nicht mehr für sinnvoll gehalten wird, so kann er einen neuen Stiftungszweck beschließen.
Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der Mitglieder des Stiftungsrats.
2) Da es sich bei der Stiftung um eine selbstständige fromme Stiftung im Sinne des
Kirchenrechtes handelt, ist ein Beschluss über eine Änderung des Stiftungszweckes -
unbeschadet stiftungsrechtlicher Genehmigungserfordernisse - nur mit schriftlicher
Zustimmung des Erzbischofs von Köln rechtswirksam.
3) Auch nach einer Änderung des Stiftungszweckes muss die Stiftung die Voraussetzungen
einer selbstständigen frommen Stiftung im Sinne des Kirchenrechtes erfüllen.
4) Der neue Stiftungszweck muss ebenfalls gemeinnützig sein.
5) Wird das Statut des Albertus-Magnus-Instituts geändert, wird die Satzung der Stiftung
entsprechend angepasst. Der Stiftungszweck muss von dieser Anpassung unberührt bleiben.
§17 Auflösung der Stiftung
Der Stiftungsrat kann mit Zustimmung des Erzbischofs die Auflösung der Stiftung beschließen,
wenn die Umstände es nicht mehr zulassen, den Stiftungszweck dauernd und nachhaltig zu
erfüllen.
§18 Vermögensanfall
Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt
das Vermögen an das Erzbistum Köln, das es unmittelbar zur Förderung der Wissenschaft und
Forschung im Sinne des § 2 des Stiftungszweckes, zu verwenden hat.
§19 Stellung des Finanzamtes
Unbeschadet der sich aus dem Stiftungsgesetz ergebenden Genehmigungspflichten sind
Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung der Stiftung dem zuständigen
Finanzamt anzuzeigen. Bei Satzungsänderungen, die den Zweck der Stiftung betreffen, ist zuvor
eine Auskunft des Finanzamtes zur Steuerbegünstigung einzuholen.
§20 Stiftungsaufsichtsbehörde
1) Kirchliche Stiftungsaufsichtsbehörde i.S. des § 14 Abs. 5 des Stiftungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen ist das Generalvikariat des Erzbistums Köln.
2) Die nach dem Stiftungsgesetz Nordrhein-Westfalen dem Innenministerium zugewiesenen
Rechte und Aufgaben bleiben, auch soweit dieses seine Zuständigkeit gemäß § 15 StiftG
NRW auf die Bezirksregierungen übertragen hat, unberührt.
§21 Inkrafttreten
Die Satzung trat mit dem Tage der Zustellung der Anerkennungsurkunde in Kraft und wurde durch
Beschluss des Stiftungsrates vom 13. Mai 2022 abgeändert.